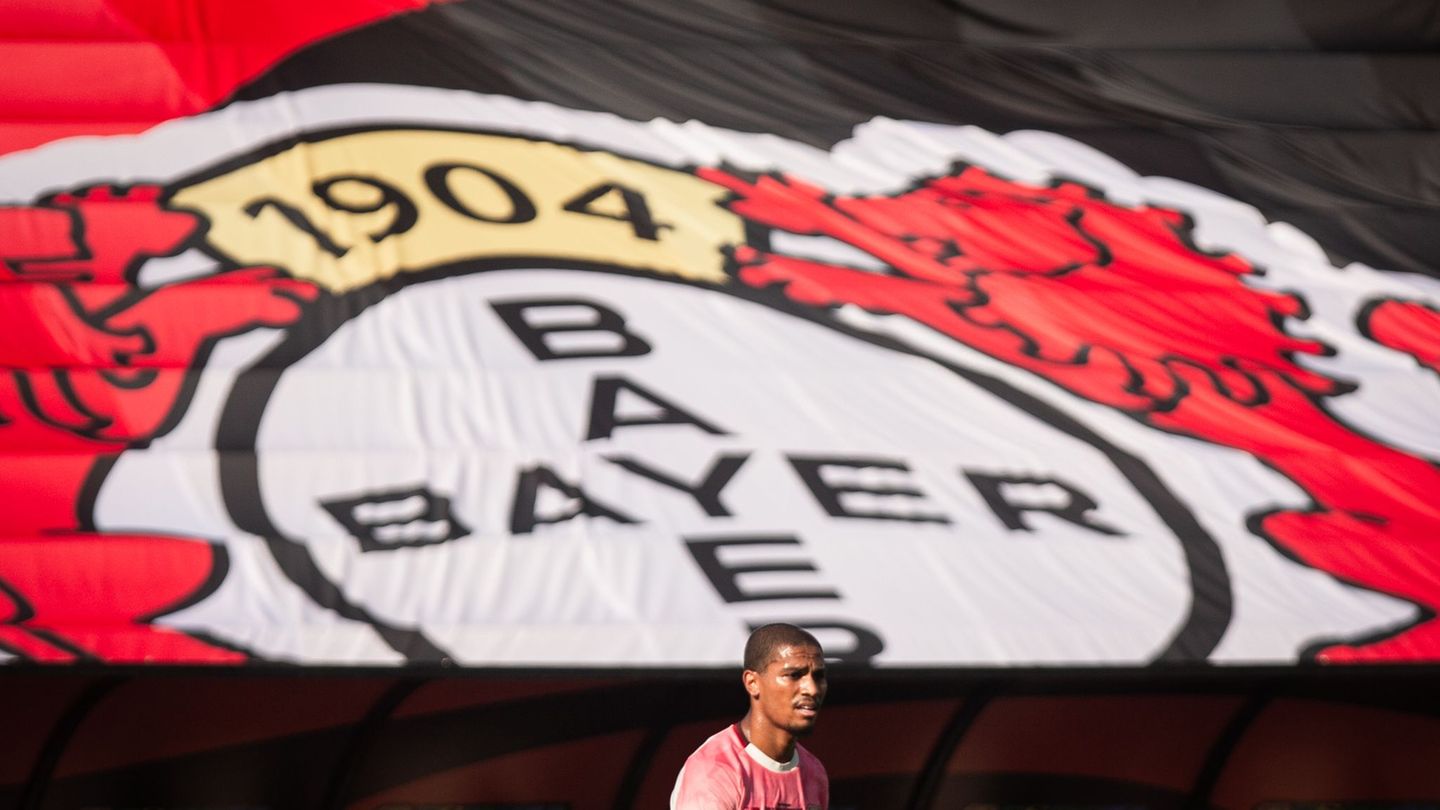Während sich die Politik in Geisterdebatten aufreibt, bleiben viele Probleme ungelöst: Der Boomer-Soli muss wenigstens seriös diskutiert werden, schreibt der Capital-Chefredakteur.
Es ist schon erstaunlich, wie viel Energie, Intelligenz und hochbezahlte Arbeitszeit das Land immer wieder auf Geisterdebatten verwenden kann. Seit etwas mehr als einer Woche etwa für die Nominierung einer Richterin am Bundesverfassungsgericht, die bis dahin kaum ein Mensch kannte und deren Arbeit die vergangenen 20 Jahre auch fast niemanden interessiert hat. Keine Sorge, das sollen die letzten Zeilen zu dieser Personalie gewesen sein – ich verweise in dieser Angelegenheit lieber auf die heutige Kolumne des früheren Bundesrichters Thomas Fischer bei den Kollegen vom „Spiegel“. Aber die Inbrunst, mit der hier jede Ecke ausgeleuchtet und ausdiskutiert wird, ist umso verstörender, da echte Probleme, die offen zu Tage liegen, seit Jahren und Jahrzehnten einfach ignoriert werden.
Zum Beispiel die Demografie und ihre Folgen. Die zahlreichen Baby-Boomer, geboren in den 1950er und 60er Jahren, bekamen vor 40 Jahren ihre Kinder; deren Nachwuchs wiederum – die Enkel der Boomer – kam vor 20 Jahren auf die Welt. Jede Generation wurde kleiner. Diese gesellschaftliche Entwicklung muss man gar nicht politisch bewerten, aber sie ist seit Jahrzehnten bekannt, ebenso wie ihre ökonomischen Konsequenzen. Doch passiert ist wenig, die letzten 18 Jahre sogar gar nichts.
Die letzte große Rentenreform gab es 2007 mit der Rente mit 67. Damals dachte man, die meisten Probleme in der Rente seien gelöst. Doch seither unternahmen diverse Bundesregierungen alles Mögliche, um diese Reform wieder auszuhebeln: Rente mit 63, Mütterrente, Rentenniveaugarantie. Das Ergebnis: Die Lage in der gesetzlichen Rentenversicherung ist heute in etwa so wie vor 25 Jahren – als hätte es all die Reformen und Auseinandersetzungen darum nie gegeben. Nur, dass wir jetzt nicht mehr 20 Jahre haben, um die absehbaren Probleme in den Griff zu bekommen.
Der Zuschuss des Bundes für die gesetzlichen Rentenkassen ist in den vergangenen fünf Jahren um fast 50 Mrd. Euro gestiegen, von 75 Milliarden im Jahr 2020 auf geplant 121 Milliarden in diesem Jahr.Der Rentenbeitrag, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Arbeitgeber zahlen, um damit die Bezüge der heutigen Rentner zu finanzieren, wird von heute 18,6 Prozent der Bruttoeinkommen auf 22,3 Prozent im Jahr 2035 steigen.Das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Rentnern wird von heute etwa 33 auf etwa 42 im Jahr 2035 steigen. Das bedeutet, dass auf 100 Arbeitnehmer in zehn Jahren knapp ein Drittel mehr Rentner kommen als heute.
Wenn man solche Zahlen auflistet, macht man sich nicht beliebt. Schnell schwingt der Vorwurf mit, man zettele eine Neid- oder Verteilungsdebatte an – die Jungen gegen die Alten. Lebensleistungen, berechtigte Ansprüche und der Wunsch nach Planungssicherheit prallen auf das Gefühl von Überforderung und fehlenden eigenen Möglichkeiten. Und immer geht es ums Geld: Wer soll das bezahlen?
Der „Boomer-Soli“ ist ein guter Impuls
Verständlich ist daher der Reflex von Politikern, lieber über andere Themen zu sprechen. Nur, die Probleme und Konflikte gehen deshalb ja nicht weg. Auch der zweite Reflex, die Probleme mit einem Griff in den allgemeinen Haushalt zu lösen (Stichwort: steigende Bundeszuschüsse), hilft nur kurzfristig weiter. Das Geld fehlt dann eben an anderer Stelle. Es rächt sich auch, dass die Politik – trotz oder gerade wegen einer vor 25 Jahren ziemlich vermurksten Reform der privaten Altersvorsorge – lange nichts mehr getan hat, um den langfristigen privaten Vermögensaufbau zu fördern. Ein letzter Ansatz dafür war das „Altersvorsorgedepot“, das die neue Regierung unverständlicherweise nur noch für Kinder auflegen will.
Insofern war es ein guter Impuls einer Forschergruppe des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in dieser Woche, einen neuen Vorschlag vorzulegen, wie sich die absehbaren Verteilungskonflikte um die gesetzliche Rente in den kommenden zehn bis 20 Jahren zumindest abmildern lassen: Sehr plakativ schlagen die Wissenschaftler einen „Boomer-Soli“ vor, einen Extra-Obolus für jene Rentner, die im Alter besonders hohe Einkommen zu erwarten haben. Mit diesen zusätzlichen Steuereinnahmen sollten dann niedrige Renten aufgestockt werden – Umverteilung innerhalb einer Generation statt Umverteilung zwischen den Generationen.
Ja, man kann an diesem Vorschlag einiges kritisieren: Er ist kompliziert, erfordert einen neuen Verteilungsschlüssel, im Zweifelsfall auch noch Prüfungen, wer als Rentner wirklich einen Zuschuss verdient und wer nicht. Vor allem aber würde der Vorschlag gerade all jene Rentner mit höheren Steuerabzügen bestrafen, die im Erwerbsleben viel geleistet, gut verdient und viel zur Seite gelegt haben. Eigeninitiative wäre kein Vorteil mehr, sondern ein Malus.
Es gibt aber auch Argumente für die Idee: So ist das Steuersystem – und nicht die Sozialversicherung – prinzipiell der beste Ort, um einen Sozialausgleich zwischen Reich und Arm zu organisieren. Denn die Finanzämter erfassen alle Einkünfte und haben den besten Überblick, ob jemand wirklich nur eine kleine Rente erhält, oder noch nennenswerte Einkünfte aus Vermietung oder einem Aktiendepot erzielt.
Nun gibt es zahlreiche Alternativen zu einem „Boomer-Soli“, die seit vielen Jahren bekannt sind. Die einfachste – und unpopulärste – ist sicher eine weitere schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 67 auf 69 oder 70 Jahre über die kommenden zehn bis 20 Jahre. Auch dies würde helfen, das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Ruheständlern weiter im Lot zu halten.
Was sind die Alternativen
Eine andere Option wäre die Absenkung des Leistungsniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung – also das genaue Gegenteil dessen, was die Regierung derzeit mit der sogenannten Rentengarantie verfolgt. Zudem wäre dieser Ansatz wohl nur vertretbar, wenn man zugleich – das wäre auch eine dritte Option – die bereits bestehende Grundrente für Menschen, die lange gearbeitet aber stets wenig verdient haben, aufstockt. Schon heute erhalten mehr als eine Million Rentnerinnen und Rentner eine solche Grundrente. Doch auch das kostet Geld, das über das Steuersystem eingenommen werden müsste.
Eine weitere Möglichkeit, mit der Demografie und der ungleichen Verteilung von Einkommen im Alter umzugehen, praktiziert die Schweiz seit Jahrzehnten: Dort wird innerhalb der gesetzlichen Altersvorsorge massiv umverteilt, die Wohlhabenderen zahlen mit ihren Beiträgen einen Teil der Mindestrenten von Geringverdienern mit.
Der Nachteil vieler dieser Reformoptionen: Sie wirken bestenfalls langfristig, denn die bereits erworbenen Rentenansprüche älterer Arbeitnehmer unterliegen einem strengen Schutz durch das Grundgesetz. Der einfachste und schnellste Weg, die Kosten einer alternden Gesellschaft neu zu organisieren, ist und bleibt daher das Steuersystem. Der plakative Name „Boomer-Soli“ schreckt auf und wahrscheinlich auch ab – doch die Idee und der Ansatz verdienen eine ernsthafte Diskussion. Denn anders als viele Geisterdebatten werden die Alterung der Gesellschaft und ihre Folgen nicht einfach verschwinden.