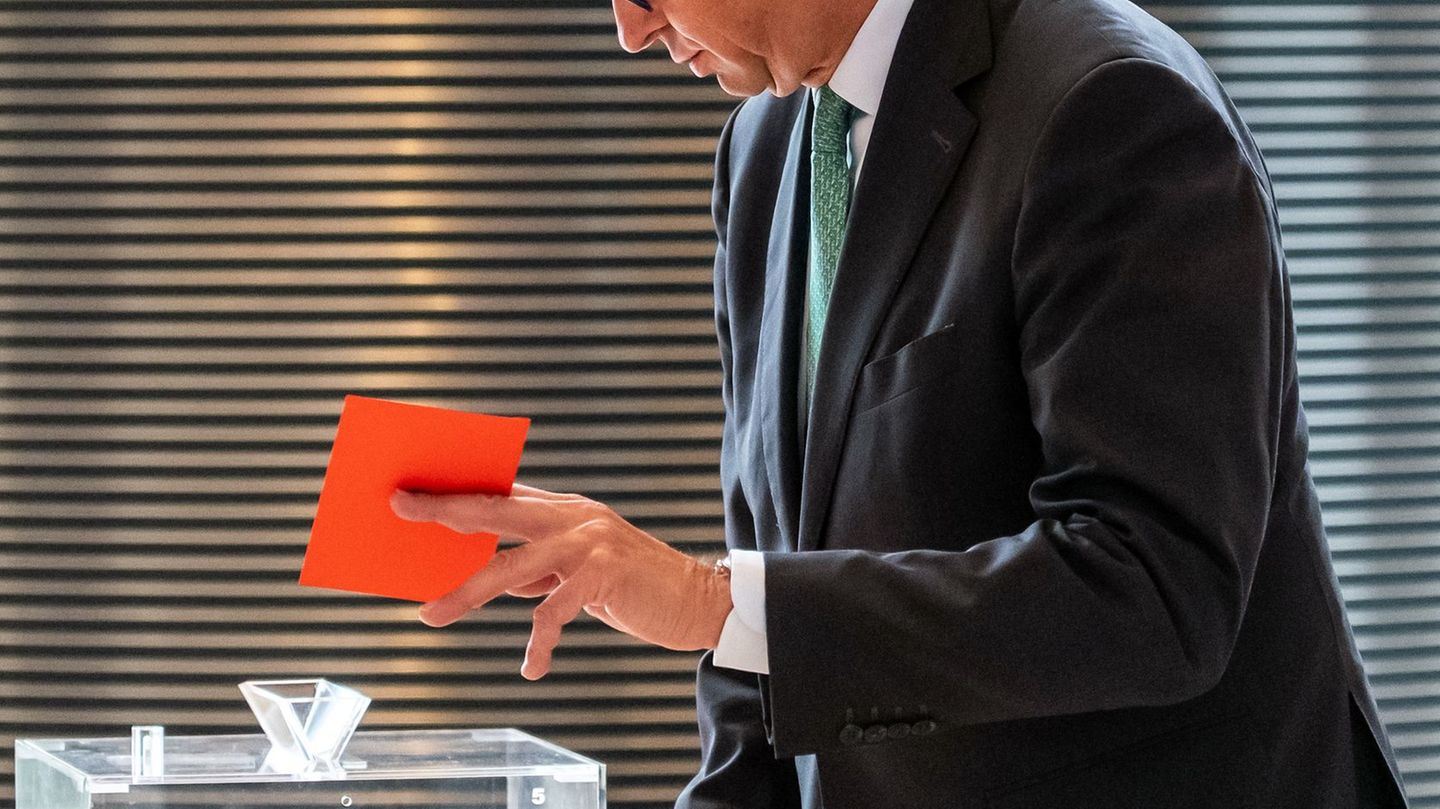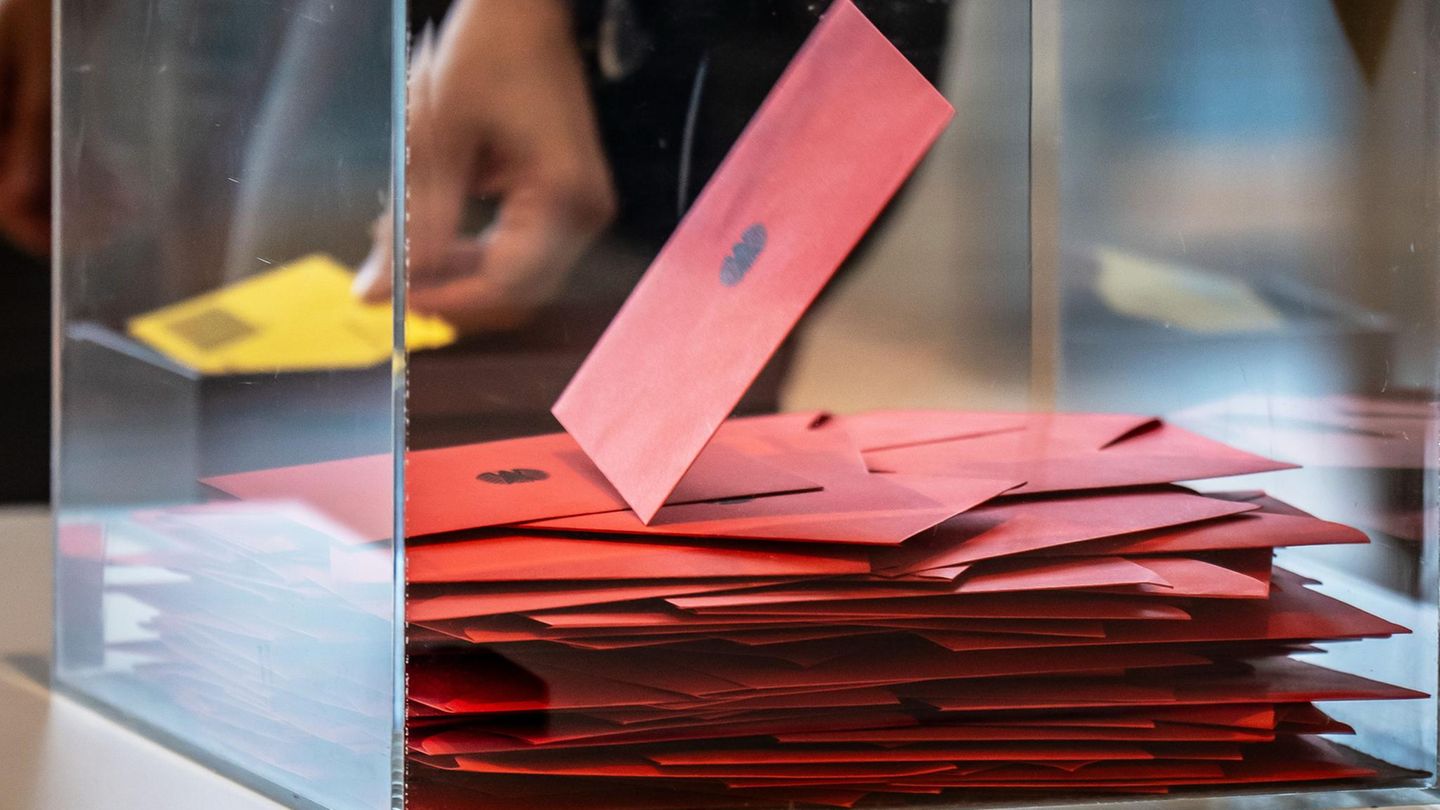Mit Hilfe einer schwimmenden Bohrplattform entnehmen Wissenschaftler Proben vom Grund des Heiligen Sees in Potsdam. Was die Ablagerungen über Klimaveränderungen erzählen.
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung (GFZ) sind mit Unter-Wasser-Bohrungen einem Klima-Archiv – gewissermaßen dem Gedächtnis – des Heiligen Sees in Potsdam auf der Spur. Von einer schwimmenden Plattform aus entnahmen die Forscher Sediment-Kerne aus dem Grund des Gewässers, in rund 13 Metern Tiefe. Ablagerungen vom Seeboden enthalten etwa Algenreste, Pollen und Asche, die im Labor analysiert werden. Sie sind laut GFZ Zeugen des vergangenen Klimas.
„Wir können damit sehen, wie schnell hat der See auf Veränderungen der Umwelt reagiert (…)“, sagte GFZ-Wissenschaftler Markus Schwab zu dem Projekt. Unklar war bislang, ob die Untersuchungen Daten etwa aus vergangenen 300 Jahren liefern oder die gewonnenen Informationen bis zu Tausenden Jahren zurückreichen. „Wir müssen gucken, was das Sediment uns sagt“, meinte GFZ-Wissenschaftlerin Sylvia Pinkerneil, die per Schlauchboot zur See-Plattform unterwegs war.
Schüler untersuchen bereits Ablagerungen im See
Ein Jugend-forscht-Projekt von 2022 und 2023 hatte bereits ergeben, dass der Grund des Gewässers in Potsdam laut GFZ so interessant ist wie Baumringe, die Jahr für Jahr Klimadaten bewahren. Dabei entnommene Proben wiesen klare jahreszeitliche Schichten auf. Das machte die Forscher des GFZ so neugierig, dass sie weitere Untersuchungen vornehmen.
Die Ablagerungen am Seeboden zeugen auch von menschlichen Einflüssen: So hatten Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Potsdam-Babelsberg gezeigt, dass Marmor-Staub im See zu finden ist. Im 18. Jahrhundert war am Seeufer das Marmor-Palais – ein preußisches Königsschloss – entstanden.
Nun hoffen die Wissenschaftler, zehn Meter lange Bohrkerne vom Grund des Sees zu gewinnen. „Ein langer Sedimentkern hat das Potenzial, eine längere Geschichte menschlicher Aktivitäten sowie von Umwelt– und Klimaveränderungen rund um den Heiligen See zu entschlüsseln“, teilte das GFZ mit. Nach der Entnahme aus dem See kommt das Material zunächst in einen Plastikzylinder und dann in die Labore.
Informationen