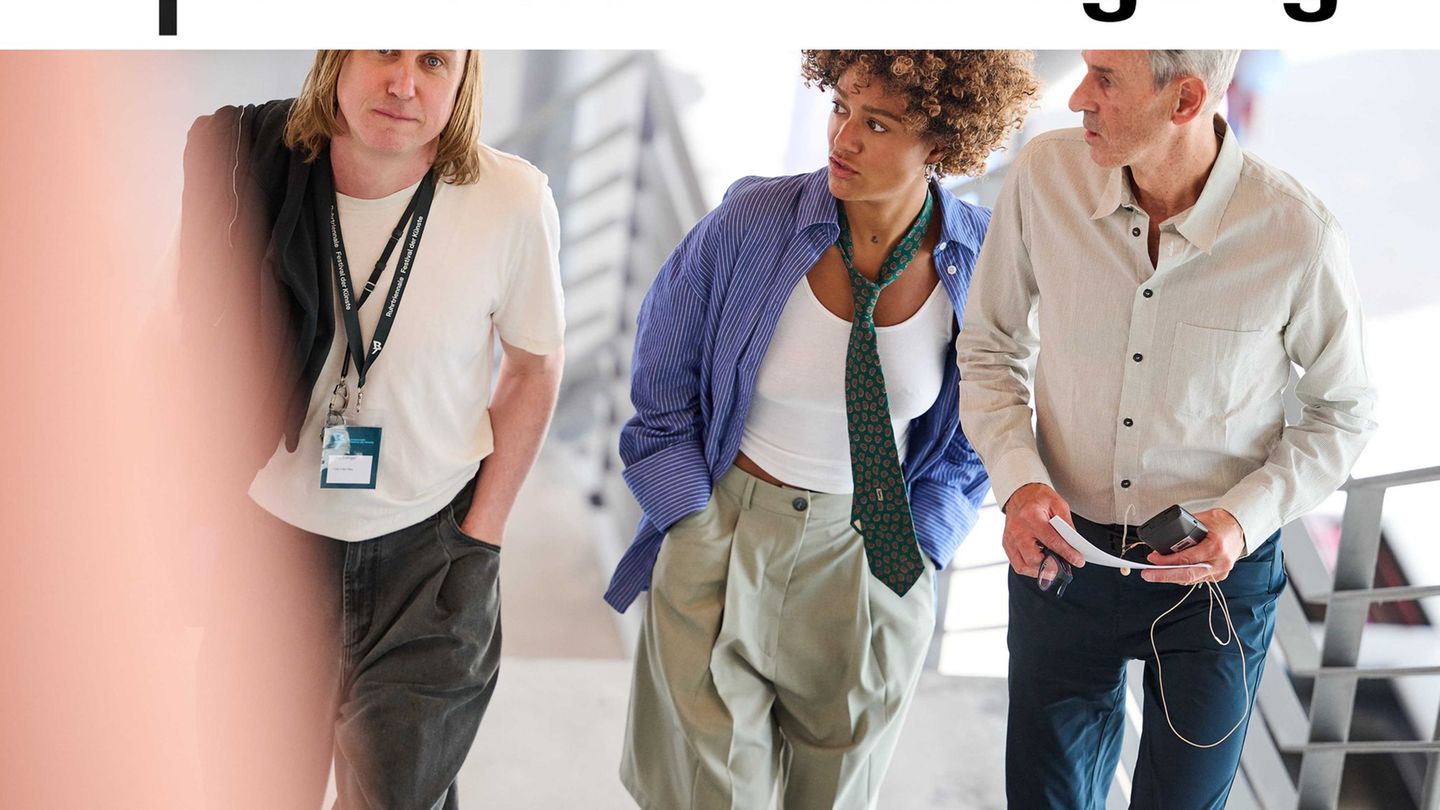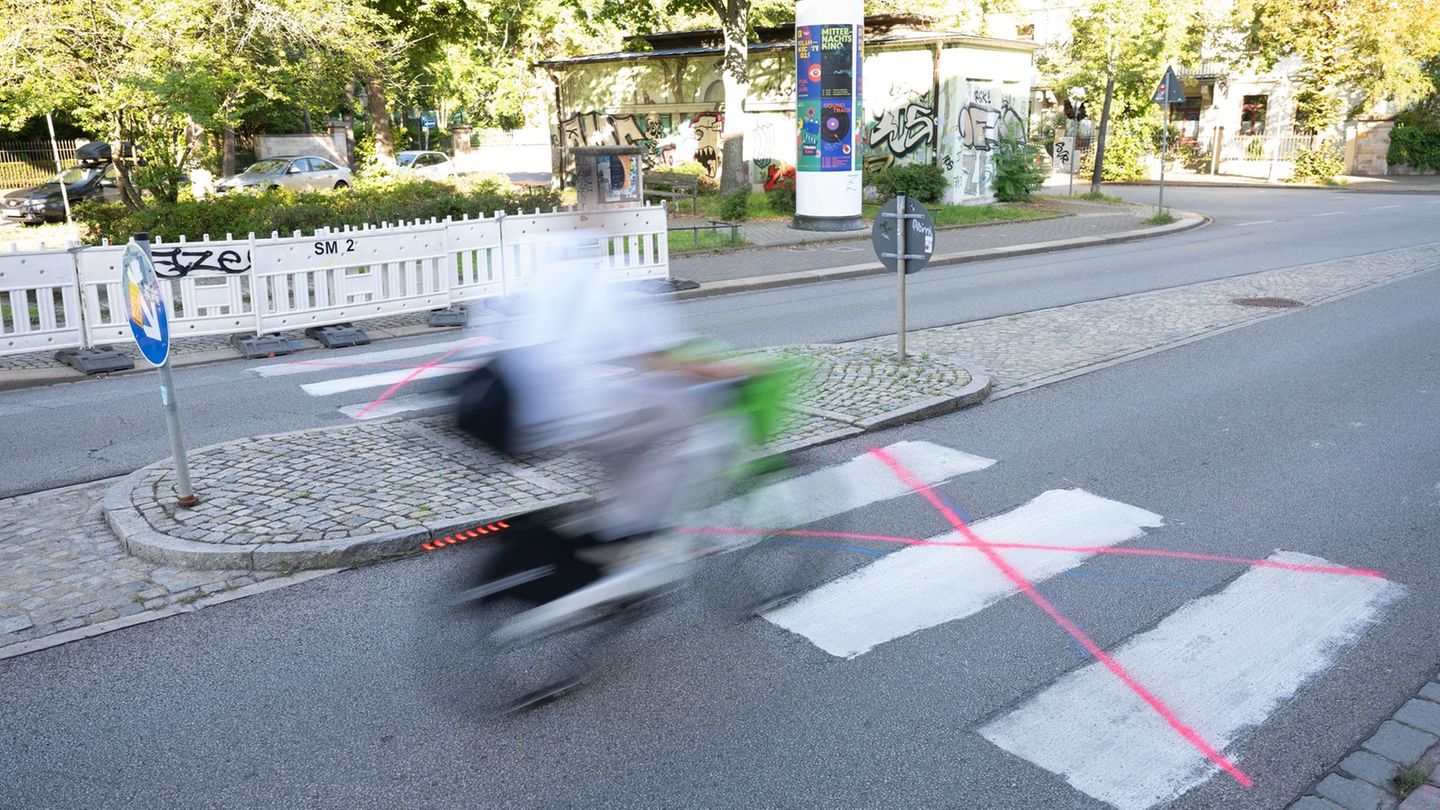Ambulante Behandlungen sollen künftig häufiger Klinikaufenthalte ersetzen. Und das ist nicht die einzige Änderung, die auf Patientinnen und Patienten zukommen dürfte.
Die komplexe Operation in dem einen Krankenhaus, der eher einfache Eingriff in einem anderen. Und häufiger der Weg zu einer ambulanten Behandlung – die medizinische Versorgung in Deutschland und Rheinland-Pfalz dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich ändern und mit ihr die Wege für Patientinnen und Patienten. Warum kommt das so? Was bedeutet das für Kliniken und Praxen? Und warum stößt das nicht nur auf Zustimmung?
Volle Notaufnahmen, lange Wartezeiten für Behandlungen, Kliniken in Finanznot und Krankenkassen, die rote Zahlen schreiben – dass es eine andere Patientensteuerung und Aufgabenverteilung braucht, ist recht offensichtlich.
„Klinikreform ist der richtige Schritt“
„Wenn wir uns mit anderen europäischen Ländern vergleichen, haben wir die meisten Krankenhausbetten, die längsten Liegedauern“, sagt der Vorstandsvorsitzende und Medizinische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, Ralf Kiesslich. „Wir haben trotzdem nicht die längste Lebenserwartung.“ Insofern müsse sich etwas tun.
„Die Krankenhausreform ist der richtige Schritt“, sagt er. Derzeit müsse die Unimedizin jemanden, der in die Notaufnahme komme und einen Grund für eine stationäre Aufnahme habe, auch versorgen. „Mit der Krankenhausreform wäre es dann möglich, solche Patienten nach der Akutversorgung direkt oder etwas zeitverzögert ganz aktiv an andere Krankenhäuser zu verlegen, dann gibt es eine Aufteilung des Patientenvolumens und nach der Schwere der Fälle.“
Das bringe Vorteile. „Wenn jemand komplexe Operationen häufiger macht, ist das Ergebnis für die Patientinnen und Patienten deutlich besser und die Komplikationsrate geringer“, sagt Kiesslich.
Der Chef der Unimedizin hält es auch für richtig, Menschen häufiger nicht mehr stationär, sondern nur noch ambulant zu behandeln. Das sieht Andreas Bartels, Vorstandsvize der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, ähnlich. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Ambulantisierung in Deutschland noch wesentlich mehr Spielraum hat“, betont er.
Was sich hinter dem Begriff Hybrid-DRGs verbirgt
Ambulant sei kostengünstiger, sagt Bartels, Einsparpotenzial müsse im Gesundheitswesen genutzt werden. Der KV-Vertreter bringt ein Beispiel: So koste die stationäre Behandlung eines Leistenbruchs bei einer oder zwei Nächten Klinikaufenthalt das System rund 3.800 Euro, ambulant seien es nur etwa 600 Euro. Trotzdem werde ein Leistenbruch in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern immer noch zu einem sehr hohen Anteil stationär behandelt.
Das könnte sich ändern. Der Leistenbruch sei inzwischen definiert als Hybrid-DRG, erklärt Bartels. DRG sind Fallgruppen, in denen vergleichbare Krankheitsfälle zusammengefasst werden und für die Kostenträger wie Krankenkassen dann entsprechend vergleichbar zahlen. Hybrid-DRG meint, dass es fortan für die Bezahlung gleich ist, ob die Leistung von einem niedergelassenen Arzt oder stationär in einem Klinikum erbracht wird.
Laut Bartels wurde bei der Ermittlung des Betrags für die Hybrid-DRG zum Leistenbruch ungefähr der Mittelwert für die stationäre und die ambulante Behandlung genommen. Es gebe also etwa 1.600 bis 1.700 Euro – egal, ob die Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulant in einer Tagesklinik erfolge.
Ambulante Behandlungen nehmen in manchen Disziplinen stark zu
Kiesslich zufolge haben Hybrid-DRGs in der Urologie und Gynäkologie schon stark zugenommen. In den kommenden Jahren erwartet er vor allem in der Kardiologie, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und der Gastroenterologie, also Magen-Darm-Erkrankungen, verstärkt eine Ambulantisierung.
Und solche Veränderungen sind für Kiesslich völlig in Ordnung. „Die Unimedizin hat sehr hohe Vorhaltungskosten“, sagt er. „Darin besteht für die Unimedizin eine Schwierigkeit.“ Sie habe alle Spezialisten, Top-OPs, Topgeräte. Eine einfache ambulante Leistung sei woanders passender aufgehoben.
Deutlich kritischer steht Gerald Gaß Hybrid-DRGs gegenüber. Er ist Präsident der Deutschen Krankenhausgellschaft (DKG) und kommt aus Rheinland-Pfalz. In der von der DKG herausgegebenen Zeitschrift „Das Krankenhaus“ sagte Gaß im Juli, Hybrid-DRGs setzten den richtigen Impuls, die Umsetzung sei jedoch falsch. Er sieht die Qualitätssicherung und Patientensicherheit gefährdet.
Krankenhausgesellschaft contra Kassenärztliche Vereinigung
Für Gaß ist ein erheblicher Teil der als ambulant potenziell möglich eingestuften Leistungen in Wahrheit nur unter Nutzung von Krankenhausinfrastruktur realisierbar. Eine einheitliche Vergütung sei eine Gleichbehandlung ungleicher Versorgungsrealitäten und führe zwangsläufig zu Fehlanreizen.
Diese Aussagen treiben Bartels von der Kassenärztlichen Vereinigung auf die Palme. „Es stimmt einfach nicht, dass das nur Krankenhäuser können“, sagt er. „Eine Behandlung kann in einer Praxis durch einen Arzt der Unimedizin geschehen – zu einem für den Patienten verlässlicheren Termin und bei weniger Kosten für das System.“ Gemeinsam könnten Behandlungspfade neu gestaltet werden. „Wir können beide voneinander lernen. Patienten sind genügend da.“
Warum Veränderungen so schleppend vorankommen
Welche ambulante Leistung ein Haus wie die Unimedizin künftig anbietet, darüber wird intern diskutiert, wie Kiesslich sagt. Man wolle ambulanter Anbieter bleiben – etwa bei onkologischen Patienten sowie chronisch kranken Menschen mit komplexen, vor allem immunologischen Erkrankungen.
„Es wird sich ein neues Muster der Versorgung ergeben, in ganz Deutschland, aber auch in Rheinland-Pfalz“, sagt Kiesslich. Doch warum dauert das so lang? „Es ist so schwierig, weil wir hier zwei getrennte Sektoren haben – also den ambulanten und den stationären. Das gibt es so ausgeprägt nur in wenigen Ländern.“ Es werde viel diskutiert, wie die teils unabhängig agierenden Systeme durchlässiger werden könnten. „Damit tun wir uns in Deutschland schwer.“