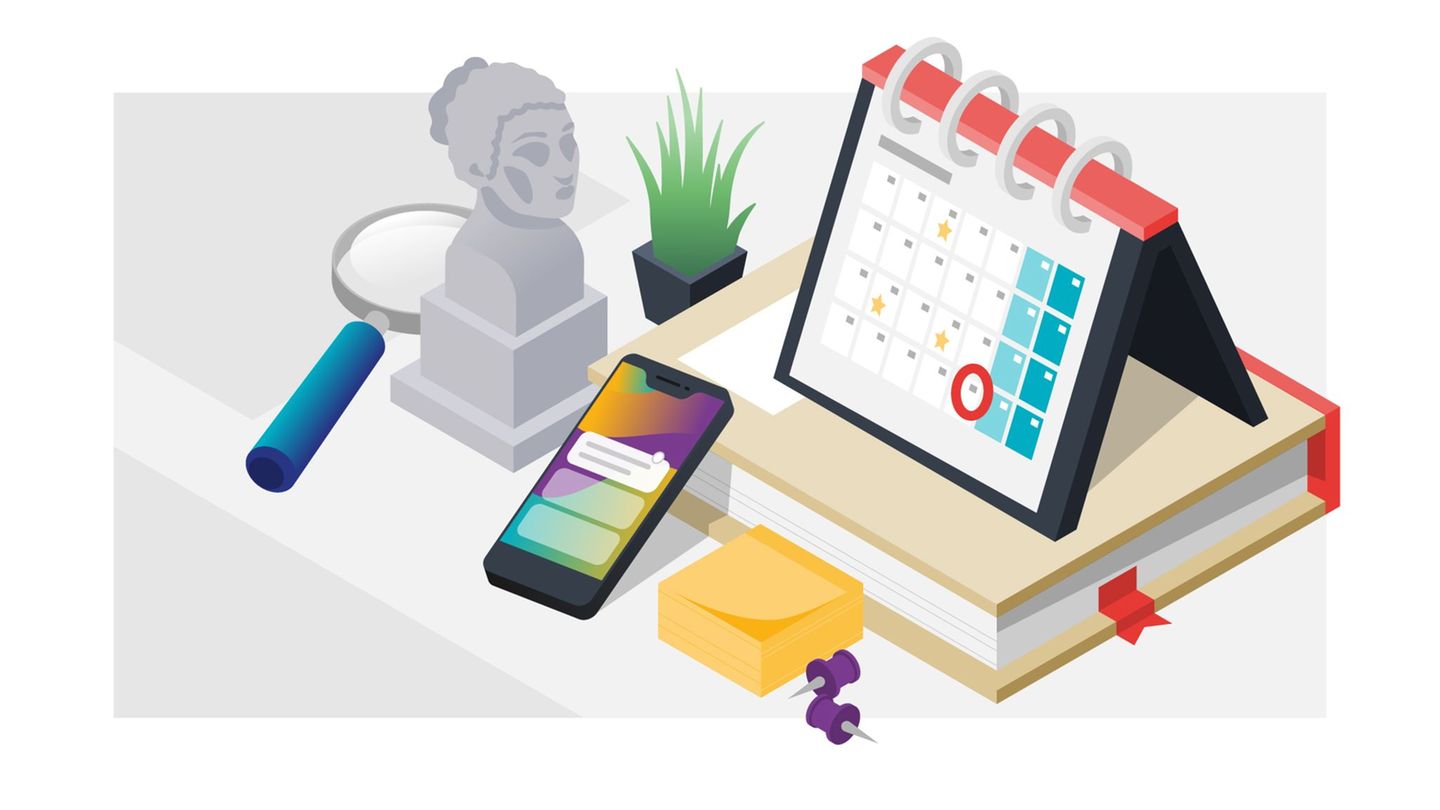1955 verbietet der Deutsche Fußballbund Frauen in Westdeutschland offiziell, Fußball zu spielen. Doch einige trotzen dem Verbot und kicken im Untergrund weiter – mit Erfolg
Alles begann – wie so oft – auf der Straße: In der Nachkriegszeit spielen die Kinder auf dem Schulhof, auf brachliegenden Flächen und auf der Straße Fußball. Zwischen den Trümmern begeistern sich nicht nur Jungen, sondern auch viele Mädchen für den Ballsport. „Wir spielten oft eine Ecke gegen die andere, Straßenanfang gegen Straßenende. Da wurde richtig rumgebolzt“, sagt die spätere Nationalspielerin Christa Kleinhans der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).
Vor allem im Ruhrgebiet ist Straßenfußball ein Trend. Auch Lotti Beckmann beginnt vermutlich mit ihren sieben Brüdern auf den Straßen in Essen den Ball zu kicken. Beckmann und Kleinhans sind Pionierinnen des deutschen Frauenfußballs. Doch bis sie vor Tausenden Zuschauern in den großen Stadien kicken dürfen, ist es ein steiniger Weg. Denn Frauen ist es in Deutschland lange Zeit verboten, Fußball zu spielen.
Schon während der NS-Zeit dürfen Frauen und Mädchen die Ballsportart nicht ausüben. Auch nach dem Krieg können Frauen nur am Rand der Gesellschaft kicken: In Hinterhöfen spielen sie mit – wenn die Männer sie lassen. Eigene offizielle Vereine existieren nicht. Die etablierten Männer-Klubs nehmen keine Mädchen auf – mit einer Ausnahme: Bärbel Wohlleben.
Die damals Zehnjährige spielt in der Jungenmannschaft in Ingelheim am Rhein. Dafür hat Wohlleben eine Sondergenehmigung vom Südwestdeutschen Fußballverband. „Ich musste da ganz besondere Prüfungen ablegen, die Jungs hatten mich aufgefordert, gegen sie Ringkämpfe auszutragen in der Weitsprunggrube, und da ich dann einige Jungs geschafft habe, war ich anerkannt und hatte seitdem vier Jahre in der C-Jugend in Ingelheim mitgespielt“, sagt Wohlleben der bpb. Doch sie bleibt ein Einzelfall.
Im Kampf um Gleichberechtigung am Ball
1954 heizt der Sieg der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft der Herren das Fußballfieber in der Bundesrepublik weiter an. In einigen westdeutschen Großstädten beginnen Frauen, sich zu Damenfußballgruppen zu organisieren. Es werden Klubs gegründet, darunter der FC Mönchengladbach, Gruga Essen, der DFC Bochum, der DFC Rhenania Essen und auch Fortuna Dortmund.
Von 1950 bis 1965 war Peter Joseph Bauwens, genannt Peco, der erste Präsident des DFB nach dem Zweiten Weltkrieg. In seiner Amtszeit blockiert er die Aufnahme von Frauen in DFB-Vereine
© Hannes Betzler / SZ Photo
Das missfällt den Funktionären des Deutschen Fußballbundes (DFB). Peter Joseph Bauwens, damals Präsident des DFB, ist vehement gegen Frauen im Fußball: „Wir werden uns mit dieser Angelegenheit nie ernsthaft beschäftigen. Das ist keine Sache für den DFB“, sagt der Verbandschef damals und räumt damit jedwede Diskussion über spielende Frauen vom Tisch. Am 30. Juli 1955 teilt der DFB mit: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“ Vereine dürfen folglich keine Frauenmannschaften gründen oder Frauen auf ihren Plätzen spielen lassen. Wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen rechnen. Das Verbot soll Frauen aus dem Fußball verbannen.
Tor für Gruga Essen! Keine halbe Stunde können dessen Spielerinnen am 30. Juli 1955 gegen die von Duisburg-Hamborn spielen, dann werden sie des Sportplatzes verwiesen – das zweite Mal an jenem Sonntag
© dpa
Am selben Tag, dem 30. Juli 1955, wollen zwei Frauenmannschaften aus Nordrhein-Westfalen gegeneinander antreten: Der DFC Duisburg-Hamborn kickt gegen Gruga Essen. Für die Duisburgerinnen ist es eine Art Heimspiel, denn sie haben für die Austragung der Partie extra den Platz der Spvgg Hamborn 90 gemietet. Doch als sie dort eintreffen, werden sie des Platzes verwiesen. Davon lassen sich die Sportlerinnen allerdings nicht unterkriegen, sie wollen kicken. Und der nächste Sportplatz ist nicht weit weg: Auf dem Rasen des Kreisklassenverbandes Hertha Hamborn duellieren sich die Rot-Weißen Hambornerinnen mit den Grün-Roten Damen aus Essen. Keine 20 Minuten nach dem Anpfiff ist schon wieder Schluss. Ein Vorsitzender des Vereins, begleitet von einem Polizisten, jagt die Kickerinnen vom Platz. Friedlich verlassen sie den Duisburger Sportplatz, doch damit ist der Kampf um den westdeutschen Frauenfußball noch nicht vorbei.
Dem Verbot trotzen
Platzverweise, Beschimpfungen, Störungen und Erniedrigungen sind für die Spielerinnen in den 50er-Jahren nichts Besonderes. Auch die Mannschaft von Fortuna Dortmund wird immer wieder vertrieben. 1955 gründen Anne Droste und Renate Bress den Dortmunder Klub. Fast alle Spielerinnen sind berufstätig. Nach Feierabend trainiert das Team auch schon mal im privaten Garten oder auf einer Kuhweide.
Mannschaftsfoto der Fortuna Dortmund: Anne Droste (Zweite von links hinten) und Renate Bress (Zweite von rechts vorne) gehören 1955 zu den Gründerinnen des Vereins
© Charlotte Morgenthal / epd-bild
1956 können die Fortuna-Frauen auf einem Platz spielen, der der Stadt Kleve gehört. „Aber die Umkleidekabinen, die gehörten dem Westdeutschen Fußballverband, die durften wir nicht benutzen“, sagt Renate Bress der bpb. „Wir mussten uns erst mal woanders umziehen, und nach dem Spiel hatte man uns das Wasser abgedreht. Da kam dann die Feuerwehr mit Schüsseln und füllte sie mit Wasser. Da durften wir uns dann notdürftig waschen.“ Im selben Jahr wechselt die damals 29-jährige Christa Kleinhans vom Konkurrenzklub Grün-Weiß Dortmund zur Fortuna. „Ich kann mich noch gut an die Quälereien vom DFB erinnern“, sagt Kleinhans mehr als 50 Jahre danach über die bewegte Zeit des Verbots.
Fortuna Dortmund ist ein „wilder“ Verein – Teams aus Essen, Oberhausen und Mönchengladbach kicken ebenfalls weiter, im Untergrund, trotz der DFB-Blockade. Auch einige Männer scheinen das Verbot für verkehrt zu halten. Einer von ihnen ist Josef Floritz. „Herr Floritz hat alles in die Wege geleitet, um den Damenfußball publik zu machen. Er hat gewiss Schwierigkeiten gehabt mit den Verbänden“, sagt Kleinhans dem Deutschlandfunk. Auch in den Kreis- und Landesverbänden des DFB sitzen vermutlich einige einsichtige Vorsitzende. Andernfalls wären die inoffiziellen Frauenländerspiele, die deutsche Damen ab 1955 in Stadien im Ruhrgebiet, in München oder auch in Berlin absolvierten, nicht möglich gewesen.
Länderspiel unter falschem Namen
Floritz trainierte zunächst die Männermannschaft von Borussia Neunkirchen. Ab Mitte der 1950er-Jahre organisiert er Spiele zwischen europäischen Frauenteams. Mit Spielerinnen aus Essen, Dortmund, Nürnberg und München stellt er eine Länderspielmannschaft auf. Mit dabei ist damals auch Fortuna-Gründerin Anne Droste. „Ich wollte nicht, dass in der Firma bekannt wurde, dass ich Fußball spiele. Ja, und da hab ich beim ersten Länderspiel unter falschem Namen gespielt“, sagt sie später der bpb.
Der 23. September 1956 wird ein historischer Tag. An diesem Sonntag spielen elf Frauen aus Westdeutschland in schwarz-weißen Nationaltrikots gegen elf Frauen in orangefarbenem Sportdress aus Holland. 18.000 Menschen schauen dem ersten Länderspiel einer westdeutschen Frauenfußballmannschaft zu. Mittelstürmerin Lotti Beckmann schießt das erste Tor im Essener Mathias-Stinnes-Stadion. Die Deutschen gewinnen das Spiel mit 2:1. „Der Name Beckmann wird zweifellos in die Damenfußballgeschichte eingehen“, heißt es damals in einem Spielbericht der Neuen Deutschen Wochenschau. Bis heute hat ihr Name es nicht in die Hall of Fame des deutschen Fußballs geschafft. Die Ruhmeshalle im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ehrt gegenwärtig 47 Personen. 16 davon Frauen, darunter sind auch Bärbel Wohlleben als „weiblicher Beckenbauer“ und Christa Kleinhans als Pionierin des deutschen Frauenfußballs.
Nach dem ersten Länderspiel folgen weitere: Gegen Holland, gegen England, gegen Österreich und gegen Italien spielen die deutschen Damen. Bis 1965 kicken sie rund 150 der „Länderrepräsentativen-Partien“. Auf der Position Rechtsaußen ist Christa Kleinhans bei fast allen Spielen dabei.
Irgendwann können die Männer vom DFB den Erfolg der Frauen im Fußball einfach nicht mehr leugnen. Am 31. Oktober 1970 hebt der Verband das Verbot schließlich auf. Frauen dürfen nun offiziell auch in den DFB-Vereinen Fußball spielen. Und der Andrang in den darauffolgenden Jahren ist groß: Mehr als 200.000 weibliche Mitglieder hat der Verband bis Mitte der 1970er-Jahre. Heute sind es rund eine Million registrierte Fußballerinnen von insgesamt acht Millionen Mitgliedern.