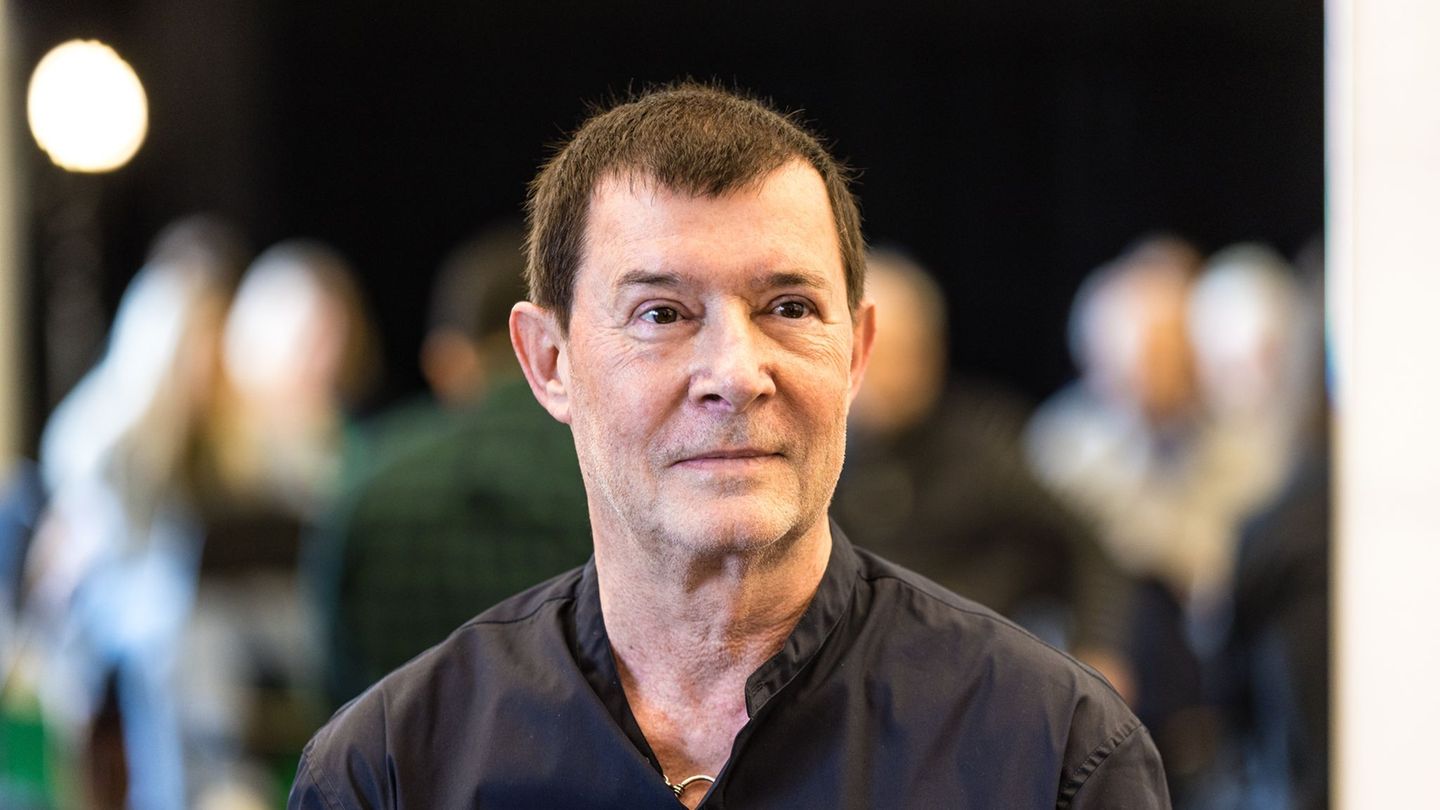Der Posten des Ost-Beauftragten ist ein gar wechselhaftes Wesen. Dabei kann er durchaus relevant sein. Man muss es nur wollen – und da gibt es leider wieder ein Problem.
Das zunehmend verzagte Selbstgespräch der Deutschen über das, was sie „Die Einheit“ nennen, variierte kaum über die vergangenen dreieinhalb Jahrzehnte. Okay, ging es lange um die Rentenpunkte, wird jetzt bevorzugt über Repräsentationslücken geredet. Und bezichtigte man einst die Ostdeutschen, die PDS wählten, des ewigen Stalinismus, gelten nun jene, die für die AfD stimmen, als Retro-Nazis – wobei sich diese pauschale Behauptung leider ebenso wenig pauschal dementieren lässt.
Und dann fiel auch noch dem Gothaer Dirk Oschmann aus Leipzig ein, dass wir Ossis die neuen Orientalen seien, nur bedauerlicherweise ohne Sindbad, den Seefahrer.
Ansonsten aber herrschte strenge Diskurskontinuität. So wogt und wogt der Streit um den Solidaritätszuschlag, obwohl er seit einigen Jahren nur noch rudimentär existiert – und sowieso, um es sicherheitshalber noch einmal möglichen westdeutschen Mitlesenden mitzuteilen, schon immer auch von Ostdeutschen gezahlt wurde. Derweil gingen, Überraschung, die Einnahmen nie exklusiv ins sogenannte Beitrittsgebiet, sondern stets in den Gesamtetat. Ja, echt!
Und dann gibt es natürlich noch die im Bundestagswahlrhythmus wiederholte Debatte um den Ost-Beauftragten, oder, wie aktuell der Fall: die Ost-Beauftragte. Das Besondere an dieser westöstlichen Dauerstreitstelle ist, ein gesamtdeutscher Konsens zur Überflüssigkeit des Postens existiert und nur die Begründung differiert.
Der Ost-Beauftragte und seine Demütigung
Während es im Westen heißt, dass jetzt mal Schluss sein müsse mit der Sonderstellung der undankbaren Schwestern und Brüder in der Zone, wird dem Beauftragten im Osten bestenfalls eine Alibifunktion als regierungsamtlicher Onkel Tom zugebilligt.
Das macht es für den Menschen, der gerade das Amt innehat, nicht unbedingt leichter. Zum Beispiel. Als ich zur Jahrtausendwende als Mitarbeiter beim früheren Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Erfurt anfing, das sich, weil das Volk gegen die SED revoltiert hatte, nicht mehr „Das Volk“, sondern „Thüringer Allgemeine“ nannte, wurde mir sogleich die traurige Geschichte des Ost-Beauftragten Rolf Schwanitz erzählt.
Der arme Mann war kurz zuvor vom damaligen Chefredakteur Sergej Lochthofen interviewt worden. Dessen Redaktionsgespräche waren traditionell eine Mischung aus Tribunal, Verhör und Showveranstaltung. Sie brachten selbst Alpha-Politiker wie Joschka Fischer an den Rand des Nervenzusammenbruchs.
Der freundliche Herr Schwanitz besaß natürlich nie eine Chance. Das verschriftlichte, ihm zugeleitete Interview geriet denn auch zum Protokoll einer Demütigung. Aber noch musste es ja autorisiert werden.
Schwanitz beging den nächsten Fehler: Er tat das, was Politiker selbst oder über ihre Pressestellen viel zu häufig tun: Er kürzte und ergänzte wild drauflos. Die Redaktion, so die Annahme, werde es schon hinnehmen.
Tja.
Lochthofen ließ das Interview nicht drucken. Stattdessen erschien nur ein Foto von Schwanitz, umgeben von viel Weißraum. Dazu wurde mitgeteilt, dass der Beauftragte leider nicht mehr zu seinen in der Redaktion getätigten Aussagen stehen wolle.
Schwanitz war blamiert. Während sich der Chefredakteur als Held der Pressefreiheit feiern lassen durfte, galt der Ost-Beauftragte endgültig als eine Art als Frühstücksdirektor fürs Beitrittsgebiet.
Dabei war das Image unfair und falsch. Intern gilt Schwanitz noch heute als Prototyp des effizienten Ost-Beauftragten. Als Staatsminister im Kanzleramt hatte er direkten Zugang zu Gerhard Schröder und dem Bundeskabinett. Kein Gesetz und keine Durchführungsbestimmung verließ die Regierung, ohne dass sein Stab geprüft hatte, ob es Nachteile für den Osten brachte.
Ausgerechnet Schwanitz belegte also die grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Ost-Beauftragten. Doch nach ihm schrumpfte die Bedeutung des Amtes wieder zum politischen Appendix zurück. Für eine Weile galt: Wenn ein Bundesminister aus dem Osten kam, übte er einfach die Funktion nebenbei aus: erst die Sozialdemokraten Manfred Stolpe und Wolfgang Tiefensee – und schließlich sogar der westdeutsche CDU-Mann Thomas de Maizière, der, weil er in einem sächsischen Landeskabinett gedient hatte, als Wossi durchging. Außerdem war ja der letzte DDR-Ministerpräsident sein Cousin.
Angela Merkel aus Castrop-Rauxel
Später wurde der Sachsen-Anhalter Ex-CDU-Ministerpräsident Christoph Bergner mit der Beauftragten-Funktion versorgt. Und noch später übernahmen die Bundestagsabgeordneten Iris Gleicke (SPD), Christian Hirte und Marco Wanderwitz (beide CDU) den Posten. Sie wurden jeweils als Parlamentarische Staatssekretäre ans Wirtschaftsministerium angedockt.
Viel richteten sie nicht aus. Sie stellten die Jahresberichte zur Deutschen Einheit vor, nahmen an den Treffen der Ost-Ministerpräsidenten teil und absolvierten Folklore-Termine für ihren jeweiligen Minister.
Halbwegs bekannt machten sie sich nur durch Fehltritte. Hirte wurde von Angela Merkel gefeuert, weil er Thomas Kemmerich spontan zu dessen Ministerpräsidentenwahl mithilfe Björn Höckes gratulierte. Von Wanderwitz wiederum wird vor allem dafür in Erinnerung bleiben, dass er den Ostdeutschen Diktaturprägung unterstellte.
Ach so: Dass für 16 Jahre eine Ostdeutsche als Kanzlerin regierte, fiel nicht weiter auf. Angela Merkel hätte statt in Templin auch in Hamburg oder Castrop-Rauxel aufwachsen können: Es hätte für ihr Regierungshandeln keinen Unterschied bedeutet.
Und dann funktionierte es doch wieder
Der Ost-Beauftragte wurde zur Abfolge von personellen Missverständnissen. Dann aber kam vor vier Jahren Carsten Schneider – und plötzlich erhielt das Amt wieder Relevanz – und sogar ein wenig Gestaltungsmacht. Erstmals seit Schwanitz war das Amt wieder im Rang eines Staatsministers im Kanzleramt angesiedelt, inklusive Sitz im Bundeskabinett. Auch die Abteilung des Beauftragten vergrößerte sich deutlich.
Schneider hatte im Bundestag als haushaltspolitischer Sprecher, SPD-Fraktionsvize und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer gedient. Er wusste genau, wie Berlin funktioniert – aber auch der Osten, wo er aufgewachsen war und lebte. Und er kannte einfach alle in Politik und Wirtschaft, die wichtig waren. Somit war er der erste Beauftragte, der mit Bundesministern und Länderchefs auf Augenhöhe agierte.
Ob nun Ansiedlungen von Firmen und Behörden, ob Gesetzentwürfe und Förderprogramme: Schneider wurde angehört. Und ernst genommen. Dass er ein kühl kalkulierender Karrierepolitiker ist, ein Realpolitikverwalter, der stets nebenbei schaute, wo er blieb, schadet dem Amt nicht. Eher im Gegenteil.
Als erster ehemaliger Ost-Beauftragter konnte Schneider aufsteigen, er ist jetzt Bundesumweltminister. Sein alter Posten wurde nicht abgeschafft, wie es auch in diesem Wahlkampf gefordert wurde, sondern ist jetzt ans Finanzministerium von Lars Klingbeil angeklebt.
Betrachtet man es freundlich, steht Elisabeth Kaiser, so heißt die Neue, als Staatsministerin beim SPD-Vizekanzler höher in der Hierarchie als einst ein Hirte oder Wanderwitz. Trotzdem sitzt sie nicht im Kanzleramt und verfügt weder über Schneiders Netzwerk noch seine Erfahrung. Darüber hinaus ist ihre parlamentarische Lobby geschrumpft: Fast die Hälfte der ostdeutschen Bundestagsabgeordneten gehören jetzt der AfD an.
Immerhin kommt Kaiser – wie so viele ihrer Vorgänger – aus dem politisch verrückten Thüringen, und zwar aus der Rolf-Schwanitz-Geburtsstadt Gera, wo die AfD seit 2020 den Stadtratsvorsitzenden stellt und die Neonazikleinbürger regelmäßig aufmarschieren.
Sie weiß also, wie das mit dem Kämpfen geht.
Alle bislang erschienenen Kolumnen von Martin Debes finden Sie hier.